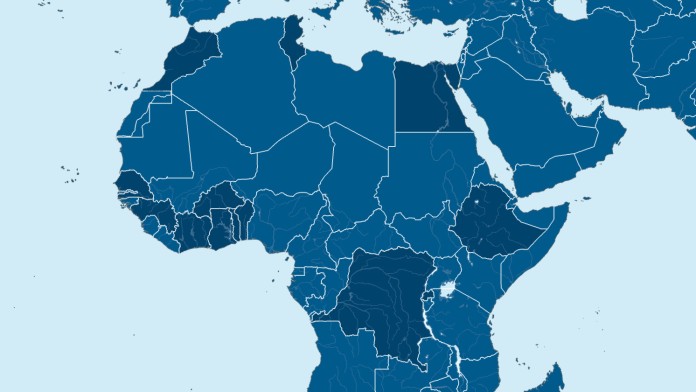
Afrika birgt große Potenziale: Ressourcenreichtum, kulturelle Vielfalt, Unternehmergeist und Innovationskraft. Etwa die Hälfte der 20 am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften befindet sich in Afrika. 2035 wird der Kontinent das größte Arbeitskräfteangebot weltweit haben. Es ist eine enorme Herausforderung, dieses Potenzial der stark wachsenden Bevölkerung zu nutzen - bis 2050 wird sie sich auf 2,5 Milliarden Menschen verdoppeln. Jeder vierte Erdbewohner wird Afrikaner sein. Hier wachsen die globalen Märkte, die Beschäftigten und Kunden der Zukunft heran.
Seit einigen Jahren steht Afrika im Fokus. Das liegt auch an der Flüchtlingsfrage, an der von vielen als Bedrohung wahrgenommenen Möglichkeit, dass in den kommenden Jahren Millionen Afrikaner Richtung Europa aufbrechen. Wo liegen die Gründe dafür, dass vor allem jungen Menschen Afrika verlassen wollen? Sie sehen in ihren Heimatländern keine Perspektive, sich ein würdiges Leben in wirtschaftlich und politisch stabilen Verhältnissen aufzubauen, mit Bildungsmöglichkeiten, Job und der Aussicht, die Familie gut zu ernähren. Und: in vielen Ländern nehmen Verfolgung, Diskriminierung, ethnische Konflikte und Menschenrechtsverletzungen zu.
Die Bundesregierung engagiert sich auf vielfältige Weise, den Nachbarkontinent Afrika in seiner Eigenverantwortung für Sicherheit und Entwicklung zu unterstützen. Ein Beispiel ist der Compact with Africa (CwA), der unter deutscher G20-Präsidentschaft initiiert wurde, um private Investitionen in Afrika zu fördern. Das Hauptziel des CwA ist es, die Attraktivität privater, nachhaltiger Investitionen durch wesentliche Verbesserungen der wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen zu erhöhen. Im Oktober 2023 ist die Demokratische Republik Kongo als dreizehntes Land hinzugekommen.
Seite teilen
Um die Inhalte dieser Seite mit Ihrem Netzwerk zu teilen, klicken Sie auf eines der unten aufgeführten Icons.
Hinweis zum Datenschutz: Beim Teilen der Inhalte werden Ihre persönlichen Daten an das ausgewählte Netzwerk übertragen.
Datenschutzhinweise
Alternativ können Sie auch den Kurz-Link kopieren: https://www.kfw-entwicklungsbank.de/s/dezBXUHG
Link kopieren Link kopiert